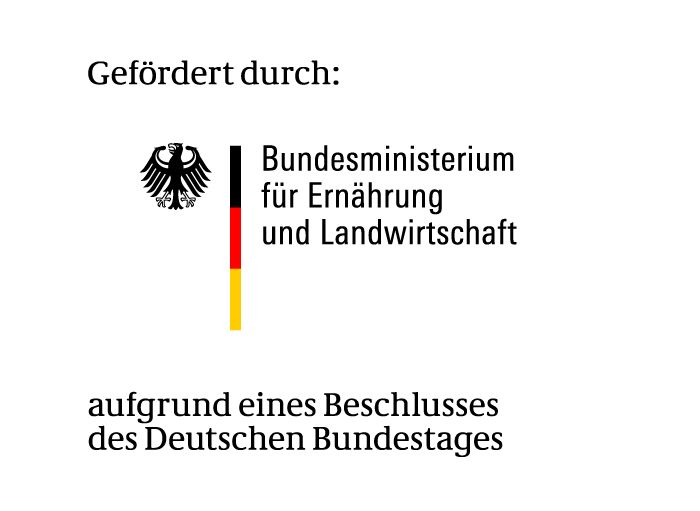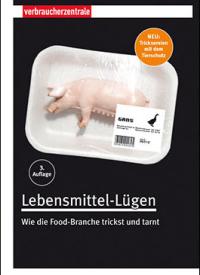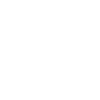Seit dem 1. Januar 2022 darf in Deutschland kein Eintagsküken mehr wegen seines Geschlechts getötet werden. Entweder werden die männlichen Küken aufgezogen oder das Geschlecht bereits im Brutei bestimmt. Dennoch ist ein genauer Blick wichtig, ob hinter einem Ei im Handel nicht doch Kükentöten steht.
Früher hielten bäuerliche Betrieben Hennen für die Eiproduktion und die männlichen Tiere für das Hähnchenfleisch. Doch Mitte des letzten Jahrhunderts wurden die Hühner gezielt für unterschiedliche Zwecke gezüchtet: Heute gibt es die Rassen der Hochleistungs-Legehennen und die Rassen der Masthühner. Die männlichen Küken der Legehühnerrassen legen natürlich keine Eier und ihre Mast lohnt sich wirtschaftlich gesehen nicht. Denn im Vergleich zu den Masthühnerrassen setzen diese Tiere nur sehr langsam Fleisch an. Daher wurden sie bisher in der Regel direkt nach dem Schlüpfen getötet. Das betraf alle Haltungsformen – auch die "Brüder" der Bio-Legehennen.
In Deutschland wurden jedes Jahr rund 45 Millionen männliche Küken auf diese Weise "entsorgt". Das betraf nur die männlichen Küken der Legerassen. Bei den Masthühnern wurden keine Küken getötet, da hier beide Geschlechter gemästet werden.
Töten der Eintagsküken ist in Deutschland per Gesetz verboten
Seit dem 1. Januar 2022 ist das Töten von männlichen Eintagsküken in Deutschland per Gesetz verboten. In §4c des Tierschutzgesetzes steht, dass es verboten ist, Küken von Haushühnern der Art Gallus gallus zu töten. Entweder werden in Deutschland nun die männlichen Küken der Legehühnerrassen aufgezogen oder das Geschlecht der Embryonen wird in den Brütereien bereits im Brutei bestimmt und die Eier mit männlichen Embryonen werden aussortiert. Ab dem 13. Bebrütungstag ist auch die Geschlechtsbestimmung im Brutei und das Töten der männlichen Hühnerembryonen verboten (siehe unten).
Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) kritisiert das Gesetz "als nationalen Alleingang der Bundesregierung", der Wettbewerbsnachteile für die deutsche Geflügelwirtschaft bringe. Denn dieses Gesetz gelte nur für Brütereien in Deutschland. Ausländische Brütereien können weiterhin die männlichen Küken am ersten Lebenstag töten.
"Deutsche Eier" garantieren nicht automatisch "ohne Kükentöten"
Das Gesetz bedeutet nicht, dass grundsätzlich für deutsche Eier keine Eintagsküken mehr getötet werden. Denn oft finden das Schlüpfen und die Aufzucht der Küken in anderen Betrieben statt als später dann die Haltung und das Eierlegen der erwachsenen Tiere. Das heißt: Legehennen-Betriebe in Deutschland können Junghennen einkaufen, die in ausländischen Brütereien geschlüpft sind, die auch weiterhin männliche Eintagsküken töten.
Die Eier dieser Legehennen können als deutsche Eier verkauft werden. Wer diese Eier nicht kaufen möchte, muss auf die Kennzeichnung "ohne Kükentöten" oder das „KAT“-Siegel achten.
KAT ist der Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V.. Er kontrolliert viele der Eier im deutschen Einzelhandel und schreibt vor, dass alle teilnehmenden Betriebe das Verbot des Tötens der männlichen Eintagsküken umsetzen. Das bedeutet, dass alle KAT-zertifizierten Eier - unabhängig davon, ob die Eier in Deutschland oder einem anderen europäischen Nachbarland gelegt wurden –, nur noch von Hennen stammen dürfen, deren "Brüder" nicht getötet wurden.
Supermärkte werben auf Eierpackungen mit dem Logo "ohne Kükentöten"
In vielen Geschäften werben Eier mit dem Logo "ohne Kükentöten". Aldi, Kaufland, Lidl, Edeka und Rewe machen so darauf aufmerksam, dass für ihre Schaleneier keine männlichen Küken mehr sterben müssen.
Vermieden wird das Kükentöten entweder durch die Geschlechtsbestimmung im Ei oder durch die Aufzucht der Bruderhähne. Doch welches Verfahren zum Einsatz kommt, steht nicht immer auf den Eierpackungen.
Eine repräsentative Verbraucherumfrage der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag der Verbraucherzentralen aus dem Jahr 2020 zeigt jedoch, dass fast drei Viertel der Befragten wissen wollen, welche Methode eingesetzt wurde. Sie fordern, dass auf jeder Eierpackung mit der Kennzeichnung "ohne Kükentöten" deutlich über das angewandte Verfahren (Geschlechtsbestimmung im Brutei oder Bruderhahnaufzucht) informiert werden muss.
Doch dazu ist der Handel bislang nicht bereit. Mehrfache Versuche der Verbraucherzentrale NRW, mit dem Handel in einen konstruktiven Austausch zu kommen, scheiterten.
Immerhin kann man auf der Internetseite von KAT, dem Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (www.was-steht-auf-dem-ei.de), den Hinweis finden, mit welcher Methode das Kükentöten verhindert wurde.
Deutsche Eier (zum Beispiel vom Wochenmarkt oder beim Ab-Hof-Verkauf), die nicht über KAT zertifiziert sind, können von Verbraucher:innen nicht über diese Website überprüft werden.
In einem Marktcheck hat die Verbraucherzentrale Thüringen 2023 Verpackungen von Hühnereiern untersucht. Auf 60 von 65 Eierkartons wurden Hinweise zum Kükentöten gefunden. Welches Verfahren angewandt wurde, war nur bei knapp der Hälfte zu erkennen. Alle Ergebnisse des Marktchecks finden Sie hier.
Die Geschlechtsbestimmung im Brutei
Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat seit 2008 die Entwicklung von Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei mit mehreren Millionen Euro gefördert. Derzeit sind folgende Verfahren zugelassen:
Ziel der Verfahren ist es, Bruteier mit männlichen Embryos bereits vor dem Schlüpfen auszusortieren.
Alle marktreifen Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei sind bisher auf den Zeitraum vom 9. bis 15. Bebrütungstag ausgelegt (von insgesamt 21 Bruttagen). In Deutschland ist nach dem deutschen Tierschutzgesetz eine Geschlechtsbestimmung im Brutei nur bis zum 12. Bruttag erlaubt.
Inzwischen haben sich die Verfahren der Geschlechtsbestimmung im Brutei in den Brütereien etabliert. Die Geschlechtsbestimmung im Brutei ist das dominierende Verfahren zur Vermeidung des Kükentötens geworden. Bei etwa 70 Prozent der „Ohne Kükentöten“-Eier wurde ein solches Geschlechtsbestimmungsverfahren angewendet. Die Bruderhahnaufzucht wird immer seltener.
Die deutschen Bio-Verbände Bioland, Naturland, Demeter, Biokreis und gäa e.V. haben sich gegen die Geschlechtsbestimmung im Brutei entschieden. Ihr langfristiges Ziel ist es, die Entwicklung der Zweinutzungsrassen voranzubringen und flächendeckend einzusetzen.
Lediglich der Anbauverband Biopark schließt für seine Mitglieder die Geschlechtsbestimmung im Brutei nicht aus.
Initiativen, die Brüder der Legehennen aufziehen
Wer Eier konsumiert, hat schon seit einigen Jahren Alternativen, um das Kükentöten zu verhindern. Das Prinzip ist bei allen gleich: Der Eier-Preis beinhaltet einen Aufschlag, mit dem die teure Mast der Legehennen-Brüder quersubventioniert wird. Durch den Zuschuss aus dem Eier-Verkauf bleibt das Fleisch der Hähne bezahlbar. Einige Initiativen, die bundesweit oder in weiten Teilen Deutschlands aktiv sind, stellen wir nachfolgend vor. Darüber hinaus gibt es weitere regionale Initiativen. Wir bitten um Verständnis, dass wir keinen abschließenden Überblick geben können.